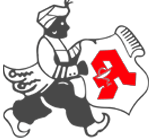Eltern & Kind
Der erste Schrei, der erste Blick, das erste Lächeln – es gibt nichts Schöneres als die vielen intensiven Erlebnisse mit dem eigenen Kind. Einfach faszinierend, dabei zu sein, wenn aus einem so kleinen Menschen ein großer wird.
Wir verstehen es als eine wichtige Aufgabe, Eltern und Kindern zur Seite zu stehen. Sie in allen Fragen der Gesundheit zu beraten. Und für sie da zu sein, wenn es gilt, Krankheiten so schnell wie möglich zu besiegen.

Unerfüllter Kinderwunsch
Sie sind bereit, den Schritt zur Familie zu gehen, aber irgendwas steht diesem Wunsch im Weg. Sehr gerne können Sie mit uns drüber reden. Wir erklären Ihnen, welche Faktoren bei der Frau und beim Mann eine Rolle spielen und welche Untersuchungen hilfreich sind, um Ihren Wunsch wahr werden zu lassen.

Schwangerschaft
Die Schwangerschaft ist in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Zeit. Deshalb verdient sie auch eine ganz besondere Begleitung. Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner und stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie Fragen haben oder Ungewöhnlichkeiten auftauchen. Schließlich sollen diese besonderen Monate für Sie trotz allem besonders schöne sein!

Geburt und Stillzeit
Die ersten Wochen und Monate mit dem eigenen Kind sind ein faszinierendes Kennenlernen. Allerdings versteht man nicht immer sofort, was gerade verlangt, gebraucht oder gewünscht ist. Wir freuen uns darauf, die vielen ersten Schritte gemeinsam mit Ihnen zu gehen und Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung zu stellen.

Vorsorge für Kinder
Niemand kann sagen, was die Zukunft bringen wird. Aber wir können heute die Voraussetzungen schaffen, ihr morgen gesund und munter zu begegnen. Wir sind Ihr Partner für die Kindervorsorge, beraten Sie umfassend über mögliche Gefahren und wie Sie ihnen rechtzeitig begegnen können.

Kinderkrankheiten
Die wichtigen Kinderkrankheiten zu kennen und Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, kann sich für das gesamte Leben auszahlen. Denn manche von ihnen werden erst richtig gefährlich, wenn sie im erwachsenen Alter zuschlagen. Wir beraten Sie über Kinderkrankheiten und darüber, wie Sie und Ihr Kind auf der sicheren Seite bleiben.
Die Mohren-Apotheke in Celle ist ein Generationsbetrieb, der bereits seit 1950 besteht und der nach DIN ISO Qualitätsmanagement-System zertifiziert ist.
Gerne berate ich Sie zu den Themen:
- Gesundheit
- Eltern & Kind
- Vorsorge
- Kosmetik & Pflege

Bianca Uekermann Inhaberin